Ach, Kafka! Was ist das denn schon wieder für ein Meisterstück!? Arbeiterliteratur der anderen Art? Ging es in jener der 1960er- und 70er-Jahre stets um die harte Realität der werktätigen Bevölkerung, machst du das alles natürlich ganz anders. Obwohl hier, in „Ein Besuch im Bergwerk“, anfangs, im ersten Satz, alles noch seine Ordnung hat. Die Hierarchie eines Bergwerk-Unternehmens vergangener Tage wird zwar unauffällig, doch klar dargestellt. Im zweiten geht es noch eine Hierarchiestufe höher, erwähnt werden eben nicht – wie zuvor – die Ingenieure der Zwischenstufe und die Stollenarbeiter auf der buchstäblich untersten Ebene, sondern die Direktoren. Doch dann wirbelt der scheinbar unscheinbare Text gewohnte Ordnungen und Kategorien durcheinander und wird so zu einer ästhetischen Sensation. Denn es ist offenbar einer der Arbeiter, der hier erzählt, der alle Bergwerksbesucher aus der Ingenieur-Ebene präzise beschreibt, deren Verbindungen und Abhängigkeitsverhältnisse scharf beleuchtet und Vermutungen darüber anstellt, wer in welcher Beziehung zu wieder anderen steht, welche Funktion dieser oder jener auf den höheren Etagen möglicherweise auszuüben pflegt – und das mit einem Selbstverständnis, das wir angesichts der hierarchischen Verhältnisse nicht vermuten würden. Der wohl jüngste Mitarbeiter schiebe, so lesen wir, „eine Art Kinderwagen, in welchem die Messapparate liegen“, vor sich her, so kostbar, dass sie „tief in zarteste Watte eingelegt“ sind. Der Wagenschieber kenne die Funktion der Geräte nicht, ein anderer aber verstehe „offenbar die Apparate von Grund aus und scheint ihr eigentlicher Verwahrer zu sein. Von Zeit zu Zeit nimmt er (...) einen Bestandteil der Apparate heraus, blickt hindurch, schraubt auf oder zu, schüttelt und beklopft, hält ans Ohr und horcht“. Und dann ist da noch der unbeschäftigte Diener, der jenen Hochmut, den die Herren Ingenieure längst abgelegt haben, „in sich aufgesammelt zu haben“ scheint. Und so weiter. Auf diesem Sprachniveau wird hier erzählt. So souverän, so gekonnt, so komisch im eigentlichen Sinne werden Miniatur-Porträts der Gäste geboten. Dies ist also keine Arbeiterliteratur, es geht nicht um das Werken unten im Stollen – es geht um die ungewohnten Gäste dort. All die Beschreibungen des erzählenden Arbeiters – oder sollten wir besser sagen: des arbeitenden Erzählers? – sind verfasst in einer sehr eigenen, einer deutlich literarischen Sprache, mit dosiert und präzise eingesetztem Humor und gewagten Querverbindungsideen bezüglich der Figuren, welche die Gäste ja nun geworden sind. Um so selbstbewusst erzählen zu können, muss ein Geschichtenerzähler schon sehr geübt sein. Er tarnt sich hier als dokumentarisch schreibender, berichterstattender Bergmann – so, als wäre er gar nicht der Schriftsteller, der er aber nun einmal eindeutig ist: ein moderner literarischer Erzähler im Gewand des Stollenarbeiters oder im Arbeitsanzug des Bergwerkers, jedenfalls einer, der im falschen Kostüm steckt.
Womit wir natürlich, liebe Leserinnen und Leser dieser Zeilen, beim wirklichen Autor und seiner Lebenssituation sind, beim dichtenden Versicherungsangestellten in Prag. Doch das ist eine ganz andere, biographische Geschichte. Die, die wir heute mit großer Überzeugung und Begeisterung präsentieren, ist ein aus den Tiefen der Erde bzw. Literaturgeschichte geborgener Erzählschatz, zuerst im Jahr 1920 erschienen und mehr als 100 Jahre später vorgelesen von Volker Drüke.
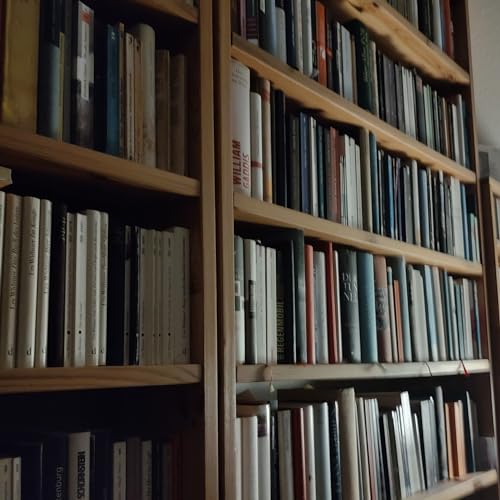 24 m
24 m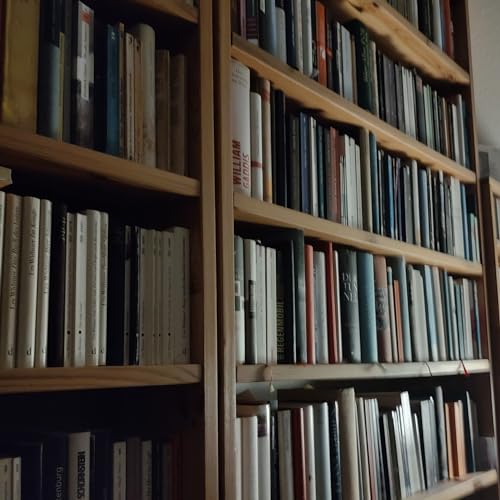 Dec 6 2025Menos de 1 minuto
Dec 6 2025Menos de 1 minuto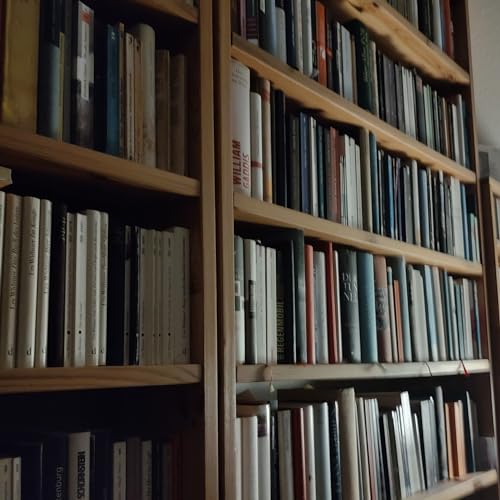 Nov 17 202544 m
Nov 17 202544 m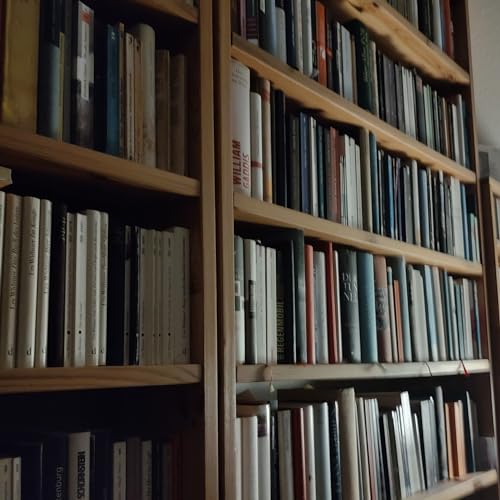 Nov 3 20257 m
Nov 3 20257 m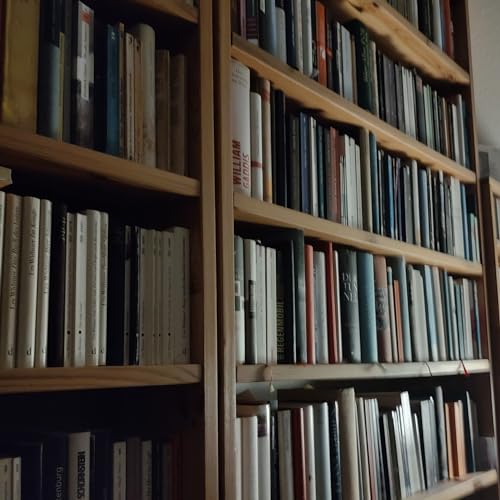 Oct 20 202541 m
Oct 20 202541 m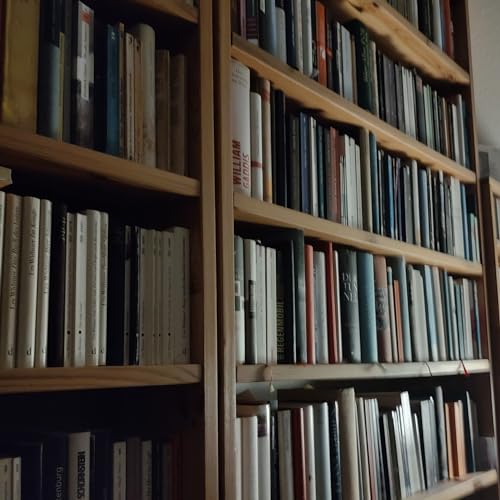 Oct 6 20257 m
Oct 6 20257 m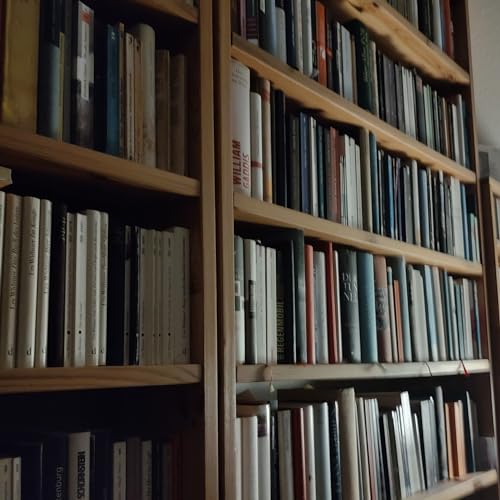 Sep 22 202516 m
Sep 22 202516 m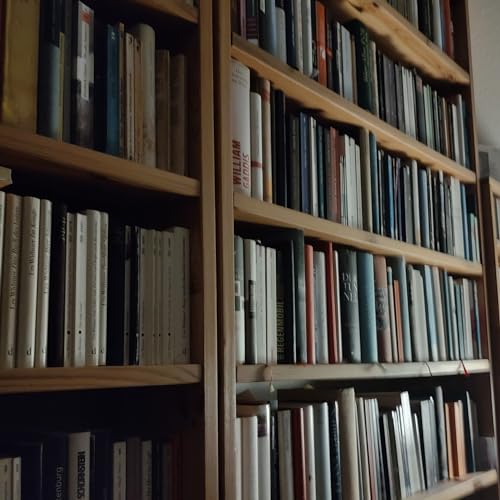 23 m
23 m
