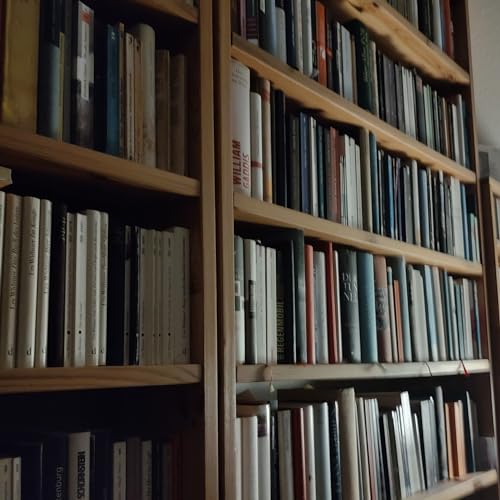
"Die Marquise von O...." (Heinrich von Kleist)
No se pudo agregar al carrito
Add to Cart failed.
Error al Agregar a Lista de Deseos.
Error al eliminar de la lista de deseos.
Error al añadir a tu biblioteca
Error al seguir el podcast
Error al dejar de seguir el podcast
-
Narrado por:
-
De:
Satzzeichen hört man nicht. Das ist schade. Denn die Novelle, die wir heute präsentieren, enthält den berühmtesten Gedankenstrich der deutschsprachigen Literatur. Und was er ersetzt, wofür er steht, ist etwas Abscheuliches: die Vergewaltigung einer Frau. Erzählt wird darüber nicht, jedoch davon, wie es dazu kam und was das alles bedeutet für die Marquise von O.... Verstoßen von den Eltern, die ihr nicht glauben, sich an nichts zu erinnern, veröffentlicht sie eine Zeitungsannonce, in der sie ihre Schwangerschaft bekanntmacht – und auch, dass sie den werdenden Vater „aus Familienrücksichten“ heiraten würde. Den Vergewaltiger! Den sie nicht kennt! Nach einigen Wirrungen taucht er auf. Was das in ihr, bei den Eltern, bei allen irgendwie Beteiligten hervorruft, ist an einigen Textstellen überraschend. Heinrich von Kleist ist ein Autor, der in seinen Prosawerken einer eigenen, sehr am Individuum und an der Emotionskultur der Empfindsamkeit orientierten Psychologie folgt – das wirkt manchmal verwirrend. Nahezu jede Szene ist dramatisch. Und Kleist schreibt radikal, exzentrisch. Die Wirkung all dessen ist immens. Selten in der Literatur begegnen wir einer solchen Erzähldichte und Gefühlsintensität, ohne dass das Ganze lächerlich oder kitschig wirkt. Das in „Die Marquise von O....“ Erzählte ist von alldem jedenfalls das Gegenteil: Es ist komplex und – entsetzlich! Zugleich ästhetisch schön.
Es gibt in diesem Text noch ein weiteres wichtiges nicht hörbares Satzzeichen, und auch dieses repräsentiert ganz Wesentliches im Leben der Marquise. Ihrem Bruder, der ihr im Auftrag des gemeinsamen Vaters die Kinder wegnehmen will, erwidert sie: „Sag deinem unmenschlichen Vater, dass er kommen und mich niederschießen: nicht aber mir meine Kinder entreißen könne!“ Der eigentümlich gesetzte Doppelpunkt markiert den Trennungsakt vom Vater. Selbst die angedrohte Gewalt – bis hin zur Tötung der scheinbar unzüchtigen Tochter! – lässt sie unerschrocken: Die Kinder bleiben bei ihr. Die Emanzipation vom bislang gesetzgebenden Vater ist längst vollzogen. Daher das Detail „Sag deinem ...“ statt „Sag unserem ...“. Sie fühlt sich nicht mehr als seine Tochter. Und doch wird noch eine lange Versöhnungsszene der beiden wiedergegeben, die Kleist merkwürdig erotisch auflädt. Dieser Autor geht halt immer aufs Ganze. Ein Grenzenüberschreiter, ein Regel- und Tabubrecher.
Sicher nicht nur: aber auch aufgrund dieser Szene sorgte die Novelle nach ihrem Erscheinen im Jahr 1808 für reichlich Protest und Unverständnis. So etwas hatte die Welt noch nicht gelesen. Wir präsentieren eine hervorragende Lesung von Margret Schmidt-John.



